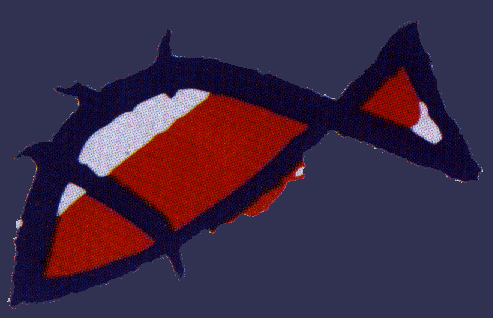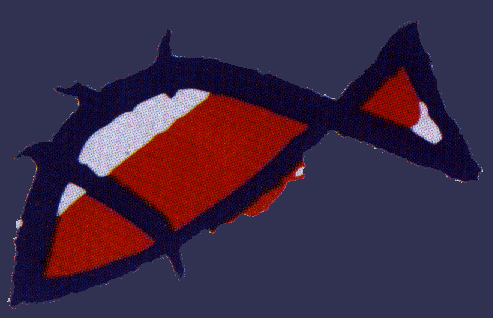|
|
Erforschung
von Glück und Mitmenschlichkeit
Prof.
Dr. Karlheinz Ruckriegel
Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule
Nürnberg, Fachbereich Betriebswirtschaft
Die
deutsche Wirtschaftspolitik will das Wirtschaftswachstum fördern.
Die Glücksforschung sagt, dass funktionierende
zwischenmenschliche Beziehungen mehr zur individuellen
Zufriedenheit beitragen als materieller Wohlstand.
Im
Englischen unterscheidet man zwischen
„lucky“ und „happy“,
also zwischen Glück haben, zum Beispiel im Lotto, und
glücklich sein, weil man sich so fühlt. Im Deutschen
existiert für beide Bedeutungen nur das Wort Glück. Die
Glücksforschung beschäftigt sich mit Glück im Sinne
des Glücksgefühls. Ihr Ziel ist, herauszufinden, was
die subjektiv empfundene Zufriedenheit mit dem Leben fördert
oder hemmt. Daraus können Handlungsempfehlungen für die
Wirtschaftspolitik und die Unternehmen, aber auch für den
Menschen
als Individuum abgeleitet werden:
Richard
Layard, Glücksforscher an der London School of Economics,
gibt zum Beispiel mit seinen Vorschlägen für eine
„aktivierende Arbeitsmarktpolitik“ Empfehlungen für die
Wirtschaftspolitik;
Unternehmen sollten Rahmenbedingungen
schaffen,
die die Zufriedenheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz und damit
ihre Motivation sowie ihr Engagement erhöhen;
für den
Einzelnen ist die Erkenntnis entscheidend, dass in den westlichen
Industrieländern weniger ein Zuwachs materieller Güter,
sondern vielmehr die Zunahme von sozialen Kontakten
und von
Mitmenschlichkeit die Lebenszufriedenheit erhöht.
Wie
wird Glück gemessen?
Ausgangspunkt für die
Glücksforschung ist die Annahme, dass Menschen nach Glück
streben und dass das oberste Ziel des Menschen Zufriedenheit,
also
mehr als bloße Einkommenserzielung, ist.
„Glück
ist, wenn wir uns gut fühlen, und Elend bedeutet, dass wir
uns schlecht fühlen“, so Layard.
Das menschliche Streben
nach Glück (Pursuit of Happiness) wurde 1776 in der
US-Verfassung als unveräußerliches Recht verankert. Es
wurde neben der Freiheit,
der Gleichheit, der Bildung und
dem
Eigentum zum Leitwort der bürgerlichen Revolution.
Jeder
Mensch hat eigene Vorstellungen von Glück, und das
beobachtete Verhalten ist kein ausreichender Indikator für
das persönliche Wohlbefinden. Dennoch lässt sich Glück
erfassen und analysieren: Menschen können gefragt werden,
wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind.
In umfangreichen
Studien werden die Befragten gebeten, ihre Lebens-zufriedenheit
allgemein bzw. ihre Zufrie-
denheit in unterschiedlichen
Lebensbereichen (Gesundheit, Arbeit, Haushaltseinkommen,
Lebensstandard, Freizeit, Wohnung, Angebot von
Waren und
Dienstleistungen, Umweltzustand) auf einer Skala, die verbal von
„ganz und gar unzufrieden“ bis „ganz und gar zufrieden“
oder numerisch
von 0 bis 10 reicht, zu bewerten.
Auf
die Frage „Hat die Glücksforschung das Zeug, eine echte
Wende im ökonomischen Denken herbeizuführen?“
antwortete Bruno S. Frey, Schweizer Pionier auf dem Gebiet der
Glücksforschung, in einem Interview mit Der Zeit vom 5. Juli
2007: „Ja,
der Effekt ist schon einigermaßen
revolutionär. Heute messen wir Zufriedenheit empirisch,
Nutzen ist also kein abstraktes Konzept mehr wie zu-
vor seit
den dreißiger Jahren.
Unsere Maße sind zwar nicht
ideal,
aber gute Annäherungen sind sie
schon. Das
Bruttosozialprodukt als vorrangige Zielgröße wird ja
auch ungenau gemessen. Aber an das Sozialprodukt haben wir uns
gewöhnt, und es wird überall akzeptiert, gerade von
traditionellen Ökonomen. Die Schätzung der Zufriedenheit
fügt dem etwas hinzu,
und das ist ein großer
Schritt vorwärts.“
Was
die Menschen wirklich glücklich macht
Die Glücksforschung
hat sieben Glücksfaktoren identifiziert: familiäre
Beziehungen, befriedigende Arbeit, soziales Umfeld, Gesundheit,
persönliche Freiheit, Lebensphilosophie (Religion) und
die
finanzielle Lage (Einkommen).
Gerade den zwischenmenschlichen
Beziehungen – zu Familienmitgliedern, Freunden oder
Arbeitskollegen –
kommt dabei eine besondere Rolle zu,
denn
„… unser Glück hängt vor allem davon ab, wie unsere
Beziehungen zu anderen Menschen aussehen. Wir
brauchen daher
eine Politik, in der die Zwischenmenschlichkeit eine große
Rolle spielt… Wenn wir nicht erkennen, wie schnell uns unsere
materiellen
Besitztümer langweilen, dann geben wir zu
viel Geld für ihre Anschaffung aus, und zwar auf Kosten
unserer Freizeit. Wir unterschätzen gern, wie schnell wir uns
an neue Gegenstände gewöhnen;
die Folge ist, dass wir
viel zu viel Zeit darauf verwenden, zu arbeiten und Geld
zu
verdienen, und andere Aktivitäten vernachlässigen.“
Die
hedonistische Tretmühle betrifft aber nicht alle Erlebnisse.
„Das Zusammensein mit der Familie, mit Freunden, Sex, ja sogar
die Qualität und Sicherheit unserer Arbeit stellen
Erfahrungen dar, an deren positive Auswirkungen wir uns nicht
gewöhnen. Glück rührt also von unseren Erfahrungen
her, vor allem von unseren Erfahrungen mit
anderen Menschen.“
Nicht die materiellen Güter, sondern die Beziehungsgüter
(Relational Goods) sind entscheidend.
Dies wird durch
Erkenntnisse aus der Neurobiologie gestützt und erklärt.
Danach ist der Mensch darauf aus, vertrauensvoll zu agieren
und gute Beziehungen zu anderen zu gestalten,
so dass er
kooperatives Verhalten einzel-
kämpferischen Strategien
vorzieht.9
Für
die Ökonomie moderner Prägung hat diesen Grundgedanken
Hermann
Heinrich Gossen Mitte des 19. Jahrhunderts in seinem
Zweiten Gossenschen Gesetz,
das vom Ausgleich der
gewogenen
Grenznutzen handelt, herausgearbeitet. Dahinter steht
der Gedanke, dass es
nachteilig ist, wenn man nicht danach
strebt, alles in ein inneres Gleichgewicht
zu bringen. Auf die
heutige Situation bezogen, in der in den westlichen
Industrieländer n die materiellen Bedürfnisse mehr
als gedeckt sind,
geht es also darum, den Nutzen
aus
materiellen Gütern und den aus Beziehungsgütern
abzuwägen und in ein inneres Gleichgewicht zu bringen.
Während ein Zuwachs bei materiellen
Gütern
aufgrund des Gewöhnungseffekts nicht zwangläufig einen
höheren Nutzen bedeutet, tritt die hedonistische Tretmühle
bei Beziehungsgütern nicht auf.
Of
fensichtlich sollten sich Ökonomen mit der Glücksforschung
und den ihr zugrundeliegenden Erkenntnissen aus der Psychologie
und Neurobiologie beschäftigen. Es handelt sich hierbei um
ihr ureigenstes Terrain. Allerdings bliebe dies nicht ohne
Konsequenzen für die ökonomische Theorie selbst. Sie
müsste radikal reformiert werden, da sie
Schlüsselergebnisse
der modernen Psychologie bislang ignoriert. So kann das Konstrukt
des Homo oeconomicus nicht
mehr länger als Leitbild des
menschlichen Verhaltens angenommen werden.
Daneben kann sich
die Volkswirtschaftlehre
als Sozialwissenschaft nicht nur
darauf beschränken, was Menschen tun, sondern sie muss auch
berücksichtigen, was Menschen fühlen und sagen –
etwas,
womit sich die moderne Psychologie schon seit über einem
halben Jahrhundert befasst.
Glücksforschung
und Wirtschaftspolitik –
Wo
steht Deutschland?
In
der deutschen Wirtschaftspolitik spielen die Erkenntnisse der
Glücksforschung bisher noch keine Rolle. Vielmehr
konzentriert sich die Politik auf
das Wirtschaftswachstum. Es
stellt sich aber die grundsätzliche Frage, warum
Wirtschaftswachstum als politisches Ziel verfolgt werden soll,
wenn Wachstum
nicht unbedingt der Schlüssel zu mehr
Glück
ist. „Wir wissen aus der Glücksforschung, dass reiche
Nationen, wenn sie noch reicher werden, nicht unbedingt
glücklicher werden.
Wir gewöhnen uns an das, was wir
erreicht
haben“, so Klaus Zimmermann, Präsident des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin.12
Ganz
anders sind die politischen Verhältnisse in den OECD-Ländern,
die auf der Glücksskala deutlich vor Deutschland rangieren:
Australien, Dänemark, Großbritannien, Irland und USA.
Diese Länder erfüllen die Forderungen, die die World
Commission on Environment and Development (die sogenannte
Brundtland Commission) der Vereinten Nationen 1987 formulierte:
neue Wege zu beschreiten, um den nachhaltigen Fortschritt von
Ländern zu messen und zu bewerten. Die Politiker dieser
Länder beschäftigen sich intensiv
mit der Frage, was
für das Wohlergehen ihrer Bürger wichtig ist. So ließ
sich der ehemalige britische Premierminister Tony Blair von
Richard Layard beraten,
der ihm einen „Happiness-Index“
vorschlug. 2005 rief Blair die Arbeitsgruppe „Whitehall
Well-Being Working Group“ ins Leben. Sie hat den Auftrag, die
Nutzbarmachung von Wohlfühl-Konzepten für die Politik zu
untersuchen.
Der Psychologe Ed Diener kommt zu dem Schluss,
dass sich Glück auf die gesamte Lebensführung positiv
auswirkt. Es ist
daher politisch notwendig, das subjektive
Wohlbefinden der Bürger zu messen
und im Zeitverlauf zu
beobachten.
Dafür müssen aber auch in Deutschland
Glück und Lebenszufriedenheit explizit in den Zielen der
Politik vorkommen.
Das BIP misst zwar die
wirtschaftliche
Leistung, nicht aber die gesellschaftliche
Wohlfahrt, für die letztlich subjektive Indikatoren
entscheidend sind.
ORIENTIERUNGEN
113
ZUR
WIRTSCHAFTS- UND GESELLSCHAFTSPOLITIK
|